Itzehoe. Bomben, die quasi am Kneipentisch gezündet werden, die Angst eines hochgerüsteten Regimes vor Handyvideos Minderjähriger, die Dämlichkeit fanatischer IS-Kämpfer und die Geldgier der Schleuser – alles das gibt es zu sehen in der Aula vom „Regionalen Bildungszentrum“ des Kreises Steinburg (rbz) in Itzehoe. Das Theaterstück von deutschen und geflüchteten Schülern erzählt die Geschichte Hamodes aus Syrien, der vor zwei Jahren nach Itzehoe kam, und heute 23 Jahre alt ist. Doch, will das zwei Jahre später noch irgendjemand sehen? Die Skepsis bei den Veranstaltern war offenbar ebenso groß wie unberechtigt, müssen doch noch schnell zusätzliche Stühle aus benachbarten Klassenzimmern geholt werden. Und die Erwartungen des großen Publikums werden nicht enttäuscht: Mit beeindruckend einfachen Mittel werden in 70 Minuten beklemmende Bilder gestellt, die unter die Haut gehen.
Für mich ist die theatralische Umsetzung doppelt beeindruckend – und eine Art Initialzündung für diesen Artikel: Ich kenne Hamode seit 2015 persönlich vom „Willkommensfest“ der örtlichen „Johanniter“. Hamode gehörte damals zu den ersten Geflüchteten, bevor die große „Flüchtlingswelle“ in ungeahntem Ausmaß ihren wirklichen Anfang nahm. Als diese schließlich ihren „Höchststand“ erreichte, ereilte mich am Freitag, den 25. September 2015, eine telefonische Anfrage, ob ich im Auftrag der „Johanniter“ eine Unterkunft für bis zu 2.000 Geflüchtete übernehmen könnte. Noch am selben Tag begannen wir mit dem Aufbau von „Camp Prinovis“ in einer ehemaligen Großdruckerei – am Montag darauf kamen die ersten Gäste.
Die Hilfsbereitschaft der Bürger war damals riesig, zwei Jahre später ist davon kaum etwas geblieben. Auch die deutsche Politik setzt inzwischen auf Abschottung und Abschiebung, die Faschisten hetzten gegen Flüchtlinge und die Bürger haben Angst vor islamistischen Terroranschlägen. In Syrien fallen derweil noch immer Bomben, das alltägliche Sterben geht weiter. Was ist in diesen beiden Jahren aus meinen ehemaligen Schützlingen geworden, möchte ich wissen, wie leben sie mittlerweile in Deutschland, haben sich ihre Hoffnungen erfüllt, gelingt die Integration oder haben sie resigniert.
 „Erste Schritte, habe ich geschafft“ hat Ayman stolz auf seiner Facebook-Seite gepostet, darunter zwei Fotos seines Zertifikates „Deutsch-Test für Zuwanderer“ vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Beim Lesen und Schreiben hat der 24jährige Syrer den Test auf Sprachniveau „B1“ gerade so bestanden, beim Sprechen hat er dagegen die volle Punktzahl erreicht. Das merke ich auch beim Interview, das wir komplett auf Deutsch führen können. Im September 2015 habe ich Ayman das erste Mal kennen gelernt, als er in das von mir geleitete Flüchtlingslager einzog und fortan mein eifrigster Übersetzer aus dem arabischen ins englische wurde. Zwei Jahre sind nun vergangenen, in denen viel passiert ist.
„Erste Schritte, habe ich geschafft“ hat Ayman stolz auf seiner Facebook-Seite gepostet, darunter zwei Fotos seines Zertifikates „Deutsch-Test für Zuwanderer“ vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Beim Lesen und Schreiben hat der 24jährige Syrer den Test auf Sprachniveau „B1“ gerade so bestanden, beim Sprechen hat er dagegen die volle Punktzahl erreicht. Das merke ich auch beim Interview, das wir komplett auf Deutsch führen können. Im September 2015 habe ich Ayman das erste Mal kennen gelernt, als er in das von mir geleitete Flüchtlingslager einzog und fortan mein eifrigster Übersetzer aus dem arabischen ins englische wurde. Zwei Jahre sind nun vergangenen, in denen viel passiert ist.
Die Trennung von der Familie macht Ayman zu schaffen, eine seiner Schwestern lebt noch immer in Damaskus, weil sie keinen Pass bekommt, eine weitere Schwester lebt mit den Eltern in Jordanien und die dritte inzwischen in Wolfsburg. Allein ist Ayman dennoch nicht, er floh 2015 zusammen mit seinem kleinen Bruder Omar. Der inzwischen zehnjährige besucht die dritte Klasse der Grundschule und schreibt nur Einsen und Zweien, während Ayman demnächst ein Praktikum als Groß- und Außenhandelskaufmann beginnen wird. Omar spielt Handball und ist mit seiner Spielvereinigung gerade Kreismeister geworden, Ayman hat sich für die Freiwillige Feuerwehr im Dorf entschieden – einen syrischen Kameraden hat es hier noch nie gegeben. Die beiden leben in der Einliegerwohnung eines älteren Ehepaares, „aber wir sind keine Mieter, wir sind eine Familie“, sagt Ayman, Omar sagt zur Vermieterin sogar Oma. Und damit nicht genug: die vier kochen zusammen, spielen zusammen, teilen sich die Gartenarbeit und ganz nebenbei wird weiter deutsch gelernt.
Nachdem die beiden kurz vor Weihnachten 2015 mein Camp verlassen hatten, absolvierte Ayman zunächst ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ im Kindergarten der „Johanniter“. „Die Kleinen waren meine besten Deutschlehrer“, sagt er heute. Nach Deutsch- und Ausbildungsvorbereitungskursen will Ayman endlich anfangen zu arbeiten. Um dafür möglichst mobil zu sein, besucht Ayman gerade eine weitere Schule, die Fahrschule. „Die theoretische Prüfung habe ich bereits bestanden“, sagt er stolz. Für die sich nun anschließenden praktischen Fahrstunden hat er bereits Hilfe seiner Feuerwehrkameraden angeboten bekommen: „Wir sperren dann die Straße für Dich, haben sie scherzhaft gesagt.“
Während Ayman neben Videos von Handballspielen Omars und Fotos der Feuerwehr ab und zu auch etwas aus Syrien und auf arabisch bei „Facebook“ postet (aber auch das wird spürbar weniger), hat der kleine Bruder überhaupt keine Erinnerungen mehr an seine erste Heimat. Mit fünf Jahren verließ Omar Syrien, lebte drei Jahre in Jordanien, in Deutschland ist er das erste Mal wirklich zuhause. Würde sein großer Bruder nicht mit ihm arabisch sprechen, Omar hätte es vermutlich schon verlernt. Der kleine daddelt am Computer wie seine Altersgenossen, spielt mit seinen Freunden im benachbarten Wald, geht zur Schule und ißt bei „Oma“ Apfelkuchen auf der mit Geranien geschmückten Terrasse. Wäre da nicht sein für deutsche Ohren ungewöhnlicher Vorname, niemand käme auf die Idee, der Kleine wäre nicht von hier. „Erste Schritte, habe ich geschafft“, hat Ayman zuletzt gepostet, und für mich besteht kein Zweifel daran, die nächsten werden die beiden auch schaffen.
 Hamode, dessen Fluchtgeschichte im Theaterstück erzählt wird, floh aus dem umkämpften Kobane ebenfalls über die sogenannte „Balkanroute“. „Deutschland war schon immer mein Traum seit ich zehn Jahre alt bin“, sagt er, „auch wegen des Fußballs“ – an Flucht hatte damals noch niemand gedacht. Selbst 2014, drei Jahre nach Ausbruch des Bürgerkrieges, plante Hamode noch ein Studium in Aleppo zu beginnen, doch dann fielen die Bomben. Seine Familie verstreute es in alle Richtungen, in die Türkei, nach Katar, nach England, Dänemark und ihn eben nach Deutschland.
Hamode, dessen Fluchtgeschichte im Theaterstück erzählt wird, floh aus dem umkämpften Kobane ebenfalls über die sogenannte „Balkanroute“. „Deutschland war schon immer mein Traum seit ich zehn Jahre alt bin“, sagt er, „auch wegen des Fußballs“ – an Flucht hatte damals noch niemand gedacht. Selbst 2014, drei Jahre nach Ausbruch des Bürgerkrieges, plante Hamode noch ein Studium in Aleppo zu beginnen, doch dann fielen die Bomben. Seine Familie verstreute es in alle Richtungen, in die Türkei, nach Katar, nach England, Dänemark und ihn eben nach Deutschland.
Sein Weg führte ihn zunächst in die Türkei, wo er als Betonbauer arbeitete, um Geld für die Schleuser zu verdienen. Diese anschließend zu finden, war leicht, sagt Hamode, „die Polizei kennt sie alle, du musst bloß fragen“. 1.400 Euro kostete ihn die wacklige Überfahrt im Schlauchboot von Bodrum nach Kos, 250 Euro pro Kilometer. Von dort ging es nach Athen, dann weiter gen Norden über Mazedonien und Serbien bis an die ungarische Grenze. Beim ersten Grenzübertritt wurden Hamode und seine Begleiter erwischt und für drei Tage ins Gefängnis gesteckt, danach zurück nach Serbien gebracht. Ihr „Retter“ war ein ehemaliger syrischer Englischlehrer, der sich der Gruppe schon vor längerem angeschlossen hatte, „ohne ihn hätten wir es nie soweit geschafft“. Hamode beginnt zu weinen, als er erzählt, was dann geschah: „Als wir es wieder versuchen wollten, nach Ungarn zu kommen, wurde der Lehrer von einem Auto überfahren, er war sofort tot.“
Neben dem Schock und der Trauer stellte sich jetzt eine grundsätzliche Frage: Was sollte mit der Leiche passieren? Sollten sie ihre Flucht abbrechen oder weiter gehen? Schließlich erklärte sich die serbische Polizei bereit, den Toten in die Türkei auszufliegen, von wo aus er nach Kobane gebracht werden sollte, um ihn zu bestatten. Hamode zahlte unterdessen weitere hundert Euro Schmiergeld an einen ungarischen Grenzbeamten, gelangte über Österreich nach München und wurde schließlich nach Schleswig-Holstein verteilt.
Bevor wir im September 2015 das Flüchtlingscamp in Itzehoe eröffneten, gab es wie erwähnt für die noch in kleinerer Zahl eintreffenden Flüchtlinge ein „Willkommensfest“ in der örtlichen Begegnungsstätte der „Johanniter“. Hamode stand abseits, konnte aber seine Augen nicht von einer jungen Frau lassen, die ein Piercing auf ihrem Dekolleté trug. Die Frau heißt Ariane und war mit ihrer Mutter Ulla gekommen. „Wir haben ihn gesehen und sofort gemocht“, sagt Ulla (59) heute an ihrem Esszimmertisch neben Hamode sitzend. Der junge Mann ist mittlerweile so etwas wie der Zieh-Sohn der Familie. Er verbrachte sein erstes Weihnachtsfest bei Ulla und deren Ehemann, nennt Ulla inzwischen „Mama“, hilft bei der Gartenarbeit. Demnächst wird er jedoch weniger bei seiner „Mama“ sein, er zieht in eine eigene Wohnung – zusammen mit Pia, seiner deutschen Freundin. Parallel besucht Hamode die Berufsschule und sucht einen Ausbildungsplatz.
Ulla freut sich sichtlich über die positiven Entwicklungen der vergangenen zwei Jahre. Ihr inniges Verhältnis zu Hamode hat auch etwas mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun: vor 16 Jahren starb ihr einziger leiblicher Sohn mit 23 Jahren an einer Überdosis Drogen. Das war auch der Grund, warum sie begann, sich unzählige Tattoos stechen zu lassen, „ich mußte mir anders weh tun, um mit diesem Schmerz umgehen zu können“. Während Ulla beim Erzählen mit den Tränen kämpft, streichelt Hamode ihr über den Rücken. Dann sagt Ulla mit Blick auf ihren tätowierten Arm: „Demnächst steht Dein Name da auch drauf“ – und lacht. Flüchtlingen zu helfen, gab Ulla ganz viel zurück, auch als sie sich zwischenzeitlich bei mir im Camp um die Ausgabe von Hygieneartikeln kümmerte. Hilfe ist keine Einbahnstraße.
 Auch Peter wollte helfen und entschied, sich als Sprachpate zu engagieren. Peter ist heute 64 Jahre alt und als Oberst a.D. bestens mit Krieg und seinen Folgen vertraut. Sein Schützling wurde per Zufall der mittlerweile 45jährige Khalid, der im Juni 2015 nach Deutschland floh. Khalid ist Jurist, arbeitete einst im syrischen Justizministerium, heute ist er arbeitslos und sitzt meist auf der Couch in seinem deutschen Wohnzimmer. Trotz intensiver Bemühungen von Seiten seines Paten, tut sich Khalid noch immer sehr schwer mit der deutschen Sprache, seine Aussichten auf einen Arbeitsplatz sind deshalb gleich null.
Auch Peter wollte helfen und entschied, sich als Sprachpate zu engagieren. Peter ist heute 64 Jahre alt und als Oberst a.D. bestens mit Krieg und seinen Folgen vertraut. Sein Schützling wurde per Zufall der mittlerweile 45jährige Khalid, der im Juni 2015 nach Deutschland floh. Khalid ist Jurist, arbeitete einst im syrischen Justizministerium, heute ist er arbeitslos und sitzt meist auf der Couch in seinem deutschen Wohnzimmer. Trotz intensiver Bemühungen von Seiten seines Paten, tut sich Khalid noch immer sehr schwer mit der deutschen Sprache, seine Aussichten auf einen Arbeitsplatz sind deshalb gleich null.
Khalids größte Sorge konnte Peter ihm aber nehmen, die um seine Familie. Ehefrau Lina (35) und die Kinder Leila (6) und Lala (4) waren zunächst in Damaskus geblieben, da die Mutter als Apothekerin einer „systemrelevanten“ Tätigkeit nachging und nicht fliehen durfte. Nachdem Khalid als Asylant anerkannt war, sollte die Familienzusammenführung jedoch gelingen. Peter stellte einen Antrag auf Familiennachzug bei der deutschen Botschaft in Ankara, damit Lina dort ein Visum erhielte. Fast ein Jahr sollte es dauern, bis die drei ihren Termin bekamen. Nun galt es bei „Nacht und Nebel“ zu entkommen. Die Flucht war lange vorbereitet, sämtlicher Schmuck verkauft, einige, wenige Sachen in einen großen Rucksack gepackt, immer sprungbereit. Zusammen mit einer kleinen Gruppe ging es mit dem Bus in die 250 Kilometer entfernte Rebellenhochburg Idlib, von dort zu Fuß weitere 50 Kilometer bis zur türkischen Grenze, Leila musste selbst laufen, die kranke Lala wurde von Mama getragen.
Tatsächlich schafften es die drei pünktlich zu ihrem Vorstellungstermin in die deutsche Botschaft im wiederum fast 700 Kilometer entfernten Ankara. Zwei Wochen später hielt Lina ihr Visum in der Hand. Mittlerweile hatte die lange Flucht jedoch sämtliche Ersparnisse aufgebraucht, Geld für einen Flug nach Deutschland hatte sie nicht mehr. Erneut sprang Peter ein, organisierte über den „Lions Club“ nicht nur drei Flugtickets, sondern auch noch etwas „Taschengeld“. Am 15. Dezember 2016 schloss Khalid am Hamburger Flughafen nach eineinhalb Jahren Frau und Kinder wieder in seine Arme. Als das Assad-Regime jedoch von Linas Flucht erfuhr, wurden deren Eltern umgehend verhaftet und gefoltert; die Mutter starb noch im Gefängnis, der Vater wenig später.
 Damit sind alle Verwandten der Familie tot, wer nicht ermordet wurde, starb im Kugel-, Granaten- und Bombenhagel. Im Gegensatz zu Khalid könnte es der zehn Jahre jüngeren Lina vielleicht noch gelingen, in Deutschland eine Anstellung zu finden, die größte Hoffnung ruht aber auf den beiden Mädchen, Leila wird nach den Sommerferien eingeschult. Eine Rückkehr in die Heimat ist für die Familie ausgeschlossen, „zumindest für die nächsten 100 Jahre“, sagt Khalid sarkastisch, „die syrische Gesellschaft ist krank“.
Damit sind alle Verwandten der Familie tot, wer nicht ermordet wurde, starb im Kugel-, Granaten- und Bombenhagel. Im Gegensatz zu Khalid könnte es der zehn Jahre jüngeren Lina vielleicht noch gelingen, in Deutschland eine Anstellung zu finden, die größte Hoffnung ruht aber auf den beiden Mädchen, Leila wird nach den Sommerferien eingeschult. Eine Rückkehr in die Heimat ist für die Familie ausgeschlossen, „zumindest für die nächsten 100 Jahre“, sagt Khalid sarkastisch, „die syrische Gesellschaft ist krank“.
„Und wir in Deutschland brauchen dringend mehr Nachwuchs“, sagt Peter sehr ernst, um mit einem Augenzwinkern hinzuzufügen, „dafür müssen wir auch mit deren Eltern leben.“ Um seinen Beitrag für eine möglichst problemlose Integration zu leisten, griff Peter durchaus auch ins eigene Portemonnaie, kaufte mit seiner Frau Anke Bettzeug und Bekleidung für Lina und die Kinder, ging mit ihnen die erste Male einkaufen. „Aber viel besser ist es, für diese Menschen da zu sein, ihnen Ratschläge zu geben.“ Und sie bei Behördengängen zu begleiten: Mittlerweile füllt die bürokratische Korrespondenz für Khalid und seine Familie einen kompletten Aktenordner in Peters Büro, angefangen bei der Ausländerbehörde, über das Jobcenter bis zur GEZ. Allein für die Befreiung vom Rundfunkbeitrag brauchte es zwei Einschreiben und sechs Monate, erzählt Peter kopfschüttelnd. „Ohne eine Betreuung durch einen Flüchtlingspaten wären diese Menschen bei uns verraten und verkauft.“ Missen möchte der ehemalige Berufssoldat die vergangenen zwei Jahre jedoch nicht: „Das ist eine enorm befriedigende Geschichte – es kommt so viel zurück an Dank und Glück.“
Das galt ebenso für meine ehemaligen Mitarbeiter im „Camp Prinovis“, ehren- wie hauptamtliche. Auch wenn die Flüchtlingsunterkunft nur drei Monate mit bis zu 1.200 Menschen belegt war, empfinden alle Beteiligten noch heute diese Zeit als unglaublich intensiv und prägend. Das lag vor allem an den Schicksalen, die uns täglich begegneten: Eine syrische Familie schickte den eigenen kleinen Sohn mit einem Onkel nach Kanada, um im Gegenzug ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft zu adoptieren, dessen Eltern im Bombenhagel starben, um mit diesem die Flucht nach Deutschland anzutreten. Ein stämmiger Iraker mittleren Alters war allein auf der „Balkanroute“ unterwegs, als er zwei kleine Kinder neben ihrer toten Mutter fand; er nahm sich der beiden an. Ein afghanisches Ehepaar hatte zwei Koffer für die Flucht gepackt, einen mit allen Zeugnissen und Papieren, einen voll mit Schmuck, um den Neuanfang finanzieren zu können – bei der Überfahrt mit dem völlig überladenen Schlauchboot mußten sie erst den einen, dann den anderen Koffer ins Mittelmeer werfen. Eine junge Frau schlug sich allein vom Jemen durch, sie hat überlebt, wird die unzählbaren Vergewaltigungen auf dem Weg aber ihr Leben lang nicht vergessen. Leichtfertig hat sich niemand unserer Gäste auf den langen Weg gemacht.
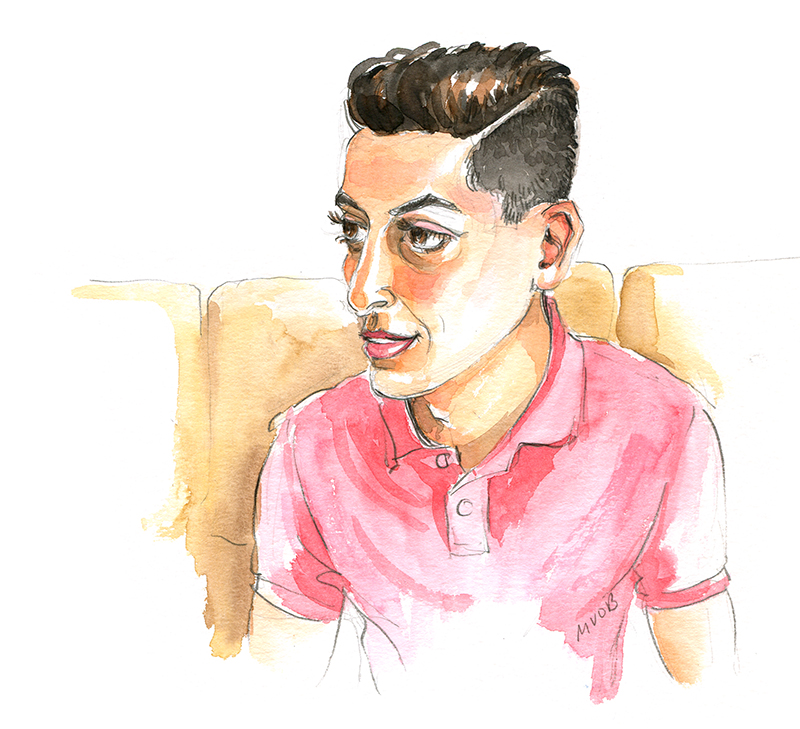 Anas und Nada stammen aus Yabrud, einer Stadt mit 45.000 Einwohnern unweit der libanesischen Grenze. Als der Krieg in ihre Stadt kam, wurde Yabrud zur Geisterstadt, niemand blieb, nicht eine Menschenseele. Anas und Nada flohen im Februar 2014 mit drei Familien über das Gebirge in den Libanon und weiter in die Türkei, eineinhalb Jahre später kamen die beiden heute 26- und 23-jährigen in Deutschland an. Hier absolvierten sie ihren 600-stündigen „Integrationskurs“ und lernten fleißig deutsch, Anas hat mittlerweile das Sprachlevel „B2“ erreicht, Nada ist sogar schon bei „C1“, was nach dem europäischen Referenzrahmen bedeutet, dass sie „die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen kann“. Und genau das wird im Herbst auch passieren: Nada hat ihre deutsche „Hochschulzugangsberechtigung“ bereits in der Tasche und wird ihr in Syrien unterbrochenes Medizinstudium wieder aufnehmen. Ob Anas erneut Tiermedizin studieren darf, ist noch unklar, wenn nicht, dann läuft es vermutlich auf Ingenieurwissenschaften hinaus, sagt er.
Anas und Nada stammen aus Yabrud, einer Stadt mit 45.000 Einwohnern unweit der libanesischen Grenze. Als der Krieg in ihre Stadt kam, wurde Yabrud zur Geisterstadt, niemand blieb, nicht eine Menschenseele. Anas und Nada flohen im Februar 2014 mit drei Familien über das Gebirge in den Libanon und weiter in die Türkei, eineinhalb Jahre später kamen die beiden heute 26- und 23-jährigen in Deutschland an. Hier absolvierten sie ihren 600-stündigen „Integrationskurs“ und lernten fleißig deutsch, Anas hat mittlerweile das Sprachlevel „B2“ erreicht, Nada ist sogar schon bei „C1“, was nach dem europäischen Referenzrahmen bedeutet, dass sie „die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen kann“. Und genau das wird im Herbst auch passieren: Nada hat ihre deutsche „Hochschulzugangsberechtigung“ bereits in der Tasche und wird ihr in Syrien unterbrochenes Medizinstudium wieder aufnehmen. Ob Anas erneut Tiermedizin studieren darf, ist noch unklar, wenn nicht, dann läuft es vermutlich auf Ingenieurwissenschaften hinaus, sagt er.
Dass aus Geflüchteten Studierende werden, ist eher die Ausnahme, meist scheitert es an nicht ausreichenden Deutschkenntnissen. Warum es bei Anas und seiner Schwester anders lief, als bei vielen anderen? „Wir haben immer den Kontakt zu Deutschen gesucht, dann musst du deutsch reden“, verrät Anas das simple Geheimnis ihres Erfolges. Abends geht es in Fitness-Studio, am Wochenende mit arabischen und deutschen Freunden in die Kneipe zum Billard spielen. Wenn der Fernseher angemacht wird, läuft deutsches Fernsehen und die Zeitungslektüre besteht aus „Zeit“ und „Spiegel“. Schnell bekam Anas wegen seiner guten Sprachkenntnisse Praktika angeboten, unter anderem in einer Tierarztpraxis. Dabei half ihm aber nicht nur, gut deutsch sprechen zu können, „du musst auch die deutschen Gewohnheiten kennen, um Missverständnisse zwischen den Kulturen zu vermeiden“. Und so gibt es während des Interviews in Anas‘ Wohnung deutschen Filterkaffee, Wasser und Guavennektar, letzteren holt er allerdings vom syrischen Laden um die Ecke.
Das Schlagwort der „Integration“ wird von beiden Geschwistern gelebt, „wir fühlen uns hier nicht mehr fremd“, sagt Anas, auch wenn seine Gedanken immer wieder einmal in die alte Heimat abschweifen würden. „Aber wir können nichts daran ändern, was in Syrien geschieht.“ Sollte es irgendwann Frieden geben, sieht er sich allerdings „in der Pflicht, mein Land wieder aufzubauen“. Wie er sich das genau vorstellt, will er abwarten, „wir bleiben hier und dort“. Was er am meisten vermisst, möchte ich bei 26 Grad Celsius Außentemperatur noch wissen? „Meine Familie und den Sommer.“
 Auch Reem war Gast im „Camp Prinovis“, floh mit Mann und Kind – und hatte selbst 4.000 Kilometer von Damaskus entfernt noch Angst vor dem langen Arm des Regimes. In ihrer Heimat war sie berühmt, trug aus Angst, hier entdeckt zu werden, deshalb entgegen ihrer Überzeugung plötzlich Vollverschleierung. Anders als bei den anderen Geflüchteten, belassen wir es bei ihr nicht nur bei dem Vornamen, sondern haben diesen auch noch geändert – die Angst ist nach zwei Jahren nicht gewichen. Reem ist mittlerweile 33 Jahre alt und hat zwei Kinder, fünf und zwei Jahre alt. Ihre Fluchtgeschichte ist eine ganz besondere, haben sie Syrien doch bereits 2011 bereits nach einem halben Jahr Bürgerkrieg verlassen und kamen nach zwei Jahren in Katar mit einem „Schengen“-Visum in die Schweiz. Von dort aus ging es weiter nach Schweden und dann nach Holland. Als die Familie dort Asyl beantragte, wurde sie aufgrund des „Dublin-Abkommens“ der EU wieder in die Schweiz geschickt, „aber da war es fürchterlich, unmenschlich“, sagt Reem. „Die Schweizer hassen Flüchtlinge.“ Also floh die Familie 2015 aus der Schweiz nach Deutschland – und landete in meinem Camp. Ich habe damals, das stimmt, entgegen der Regeln bei der Registrierung der Familie nachgeholfen, damit sie das Camp schneller als andere verlassen konnte – doch das Ergebnis ist heute ernüchternd.
Auch Reem war Gast im „Camp Prinovis“, floh mit Mann und Kind – und hatte selbst 4.000 Kilometer von Damaskus entfernt noch Angst vor dem langen Arm des Regimes. In ihrer Heimat war sie berühmt, trug aus Angst, hier entdeckt zu werden, deshalb entgegen ihrer Überzeugung plötzlich Vollverschleierung. Anders als bei den anderen Geflüchteten, belassen wir es bei ihr nicht nur bei dem Vornamen, sondern haben diesen auch noch geändert – die Angst ist nach zwei Jahren nicht gewichen. Reem ist mittlerweile 33 Jahre alt und hat zwei Kinder, fünf und zwei Jahre alt. Ihre Fluchtgeschichte ist eine ganz besondere, haben sie Syrien doch bereits 2011 bereits nach einem halben Jahr Bürgerkrieg verlassen und kamen nach zwei Jahren in Katar mit einem „Schengen“-Visum in die Schweiz. Von dort aus ging es weiter nach Schweden und dann nach Holland. Als die Familie dort Asyl beantragte, wurde sie aufgrund des „Dublin-Abkommens“ der EU wieder in die Schweiz geschickt, „aber da war es fürchterlich, unmenschlich“, sagt Reem. „Die Schweizer hassen Flüchtlinge.“ Also floh die Familie 2015 aus der Schweiz nach Deutschland – und landete in meinem Camp. Ich habe damals, das stimmt, entgegen der Regeln bei der Registrierung der Familie nachgeholfen, damit sie das Camp schneller als andere verlassen konnte – doch das Ergebnis ist heute ernüchternd.
Aus Angst, erneut in die Schweiz zurück geschickt zu werden, entschloss sich Reem’s Ehemann vor wenigen Wochen, ein Angebot seines ehemaligen Arbeitgebers in Katar anzunehmen. Kurz nach dessen Abflug (und damit dem Erlöschen jedweden Anspruches auf Asyl in Deutschland), erhielt Reem mit den Kinder den erhofften Flüchtlingsstatus. Trotzdem waren die Koffer gepackt, die Abschiedsparty vorbereitet – doch dann kam US-Präsident Trump und mit dessen Besuch in Saudi-Arabien die völlige Isolation Katars. Die Folge: Es gibt kein Visum für Reem und die Kinder, die drei sitzen in einer norddeutschen Kleinstadt fest, während der Vater in Katar den Unbilden der Weltpolitik ausgesetzt ist. Wieder einmal. So wie diese vier, sind derzeit 65 Millionen Menschen auf der Erde auf der Flucht, so viele wie noch nie, seitdem die „Vereinten Nationen“ Statistiken anfertigen.
Zu ihnen gehört auch Hamode, dessen Fluchtgeschichte im Theaterstück thematisiert wurde. Naheliegend, dass er die Hauptrolle spielen sollte, doch zwei Tage vor der Premiere starb sein Vater im syrischen Kobane. Statt seiner übernahmen alle anderen Darsteller abwechselnd seine Rolle und holten trotz Hamodes Abwesenheit die Zuschauer zum Schluss von den ursprünglich zu wenigen Stühlen. „Standing Ovations“ für eine Fluchtgeschichte, die sich auch heute noch tausendfach wiederholt, wenngleich über das noch gefährlichere Mittelmeer. Die Gratulationen erhielt Hamode trotzdem: Der „Trainer“ der „Hamburger Schauspielschule“ bat die Gäste um einen Extra-Applaus für ein Handy-Video – und Hamodes Freundin Pia war auch auf der Bühne …
Text: Lars Bessel
Zeichnungen: Marion von Oppeln






